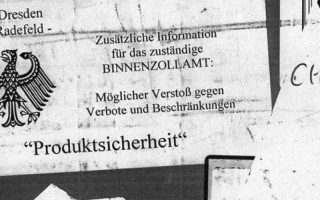In vielen Branchen schützen Designer, Erfinder, Kreative und auch Händler neue Gestaltungen mit den Mitteln des Designrechts. Wenn Sie eine Designstrategie entwickeln, Ihre Designs eintragen oder gegen Produktnachahmungen durchsetzen wollen, helfen wir Ihnen genauso gerne, wie wenn Sie wegen einer vermeintlichen Designverletzung in Anspruch genommen werden.
Designregistrierung
[elfsight_pricing_table id=“6″]
Fragen und Antworten zum Designschutz
Nach der gesetzlichen Definition bezeichnet der Begriff „Design“ die Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon. Es kann sowohl zweidimensional als auch dreidimensional sein und sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergeben. Das Designrecht schützt also alle Arbeitsergebnisse, die man gemeinhin unter Begriffen wie Produktdesign, Grafikdesign, Fashion Design, Schmuckdesign usw. bezeichnet.
Durch die Eintragung des Designs erhalten Sie eine Art Monopolrecht mit dem Sie es anderen verbieten können, Produkte mit Ihrem Design herzustellen oder zu verkaufen. Sollte also ein Dritter ohne Ihre Genehmigung Ihr Design verwenden, können Sie insbesondere Unterlassung und Schadensersatz verlangen. Daneben hat ein eingetragenes Design auch wirtschaftliche Vorteile. Es lässt sich vermarkten, indem es an einen Dritten lizenziert oder verkauft wird. Außerdem hat es einen hohen Marketingwert, den man in der Werbung für sich nutzen kann („geschütztes Design“).
Damit ein Design rechtlichen Schutz genießt, müssen vor zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Neuheit und Eigenart. Demgegenüber muss das Design insbesondere keine besondere Schöpfungshöhe oder Originalität aufweisen. Insoweit unterscheidet es sich vom Urheberrecht. Da das Design also auch reines Handwerk schützt, ist es das passende Schutzrecht für Produktdesign, Grafikdesign, Fashion Design usw.
Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Man muss also immer das Design mit dem im Zeitpunkt der Anmeldung bereits bekannten Formenschatz vergleichen. Wenn das Design bereits eins zu eins bekannt ist, oder wenn sich das Design nur in unwesentlichen Merkmalen vom vorbekannten Formenschatz unterscheidet, dann fehlt es an der Neuheit. Es gibt allerdings eine wichtige Ausnahme: Der Designer genießt eine sog. Neuheitsschonfrist. Das bedeutet, eine Offenbarung des Designs steht der Neuheit nicht entgegen, wenn das Design innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die Neuheitsschonfrist soll dem Designer Zeit geben, den Markterfolg eines Designs abzuschätzen, bevor er es rechtlich schützt.
Um zu bestimmen, ob ein Design Eigenart hat, muss man es mit den Designs vergleichen, die am Anmeldetag bereits zum bekannten Formenschatz gehören. Eigenart liegt dann vor, wenn sich der Gesamteindruck des Designs von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein vorbekanntes Design hervorruft. Das Gesetz berücksichtigt dabei den Grad der Gestaltungsfreiheit des Designers bei der Entwicklung des Designs. Es besteht also eine Wechselwirkung dergestalt, dass sich ein Design umso mehr von vorbekannten Designs unterscheiden muss, je größer die Gestaltungsfreiheit des Designers ist. Dabei bestimmt sich der Grad der Gestaltungsfreiheit auch danach, wie viele Designs in dem jeweiligen Sektor bereits existieren. Wenn es für bestimmte Erzeugnisse bereits eine Vielzahl an Designs gibt (z.B. bei Sportschuhen, Besteck usw.), dann reduziert sich die Gestaltungsfreiheit des Designers mit der Folge, dass schon ein relativ geringes Maß an Eigenart genügt, damit das neue Design schutzfähig ist.
Grundsätzlich sind der oder die Entwerfer zur Anmeldung eines Designs berechtigt. Wurde das Design übertragen, so steht dieses Recht dem Rechtsnachfolger zu. Bei Einreichung der Anmeldung wird nicht geprüft, ob der Anmelder das Recht auf das eingetragene Design hat. Damit hierüber nicht im Nachhinein Streit entsteht, empfiehlt es sich, eine etwaige Übertragung des Designs von dem Entwerfer auf einen Rechtsnachfolger mit einem professionellen Vertrag zu regeln. Gerne stellen wir Ihnen dafür einen kommentierten Mustervertrag zur Verfügung.
Als Daumenregel gilt: Je früher, desto besser! Im Designrecht gilt der sog. Prioritätsgrundsatz, d.h. ein jüngeres Design setzt sich gegen ein älteres Design durch. Da sich die Priorität grundsätzlich nach dem Anmeldetag bestimmt, ist es sinnvoll, ein Design so bald wie möglich einzutragen. Sobald das Design in das Register eingetragen wurde, können Sie dann Ihre Ansprüche (Unterlassung, Schadensersatz usw.) gegen alle Designs durchsetzen, deren Zeitrang nach dem Anmeldetag Ihres Designs liegt.
Wichtig ist, dass durch die Einreichung der Anmeldung der sog. Zeitrang Ihres Designs gesichert ist. Mit der Registrierung erstarkt die Anmeldung dann zum Vollrecht. Wie schnell dies geht, hängt von der Kapazität des Markenamtes ab. Wenn alles rund läuft, dauert die Anmeldung manchmal nur ca. einen Monat. Das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) ist dabei in der Regel etwas schneller als das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA).
Wenn man ein deutsches Design elektronisch anmeldet, spart man ein wenig Anmeldekosten. Das sind zwar nur 10 EUR, aber immerhin besser als nichts. Der eigentliche Vorteil einer elektronischen Designanmeldung ist aber, dass sie schneller geht und weniger störanfällig für Fehler ist, da die Angaben bereits bei der Eingabe validiert werden können.
Man kann eine Designanmeldung grundsätzlich auch ohne Anwalt vornehmen. Davon raten wir aber ab. Das Design wird nämlich im Wesentlichen ohne Amtsprüfung eingetragen. Umso wichtiger ist es, selbst dafür Sorge zu tragen, dass die Anmeldung ordnungsgemäß erfolgt. Fehler können im schlimmsten Fall dazu führen, dass sich das Design im Nachhinein als schutzunfähig und damit wertlos herausstellt. Um dies zu verhindern, sollten Sie einen im Designrecht erfahrenen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit der Anmeldung beauftragen.
Designverletzungen sind eine komplizierte Angelegenheit. In der Regel gibt es Querverbindungen zu anderen Schutzrechten (Marken, Urheberrecht, wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz) und ein umfangreiches rechtliches Instrumentarium (Abmahnungen, einstweilige Verfügungen, Unterlassungserklärungen, Löschungsverfahren, Verletzungsverfahren usw.). Wenn Ihr Design verletzt wurde oder Ihnen jemand vorwirft, ein Design verletzt zu haben, stehen wir Ihnen mit unserer umfangreichen Erfahrung als kompetenter und routinierter Partner.
Der Designschutz kann bis zu 25 Jahre aufrechterhalten werden. Die Zeit unterteilt sich in Schutzperioden von jeweils 5 Jahren. Dies erlaubt es Ihnen, den Designschutz (nur) so lange aufrechtzuerhalten, wie er für Sie wirtschaftlich sinnvoll ist.
Designschutz muss nicht teuer sein. Die Kosten setzen sich zusammen aus Amts- und Anwaltsgebühren. Die Amtsgebühren starten schon bei 60 EUR für ein einzelnes deutsches Design bzw. bei 350 EUR für ein sog. Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Dazu kommen Anwaltsgebühren. Im Designrecht erfahrene Anwälte können Ihnen hierzu in der Regel Festpreise anbieten. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.
Das europäische Recht schützt in einem gewissen Umfang auch Designs, die nicht eingetragen sind. Ein eingetragenes Design besitzt gegenüber einem sog. nichteingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster aber zahlreiche Vorteile.
Die Schutzdauer eines eingetragenen Designs ist länger (bis zu 25 Jahre vs. 3 Jahre). So können Sie das wirtschaftliche Potenzial eines Designs optimal ausnutzen.
Die Durchsetzung eines eingetragenen Designs ist deutlich einfacher. Der Grund ist, dass für ein eingetragenes Design die Vermutung streitet, dass die Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart vorliegen. Ein nichteingetragenes Design durchzusetzen ist demgegenüber ein Kampf bergauf, komplizierter, unsicherer und teurer.
Der Schutzumfang eines eingetragenen Designs ist größer. Aus dem eingetragenen Design kann man auch gegen (angeblich) zufällige Parallelentwicklungen vorgehen und nicht nur gegen bewusste Nachahmungen.
Ein eingetragenes Design lässt sich gut vermarkten (Stichwort Lizenz und Verkauf). Mit der Registrierung hat man etwas Handfestes, das zum Gegenstand eines Rechtsgeschäfts gemacht werden kann. Die Registrierung indiziert zudem einen gewissen wirtschaftlichen Wert. Bei nichteingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern muss man auf diese Vorteile verzichten.
Theoretisch vielleicht ja, praktisch ganz klar nein. Der Gesetzgeber hat sich schon etwas dabei gedacht, dass er beide Arten des Geistigen Eigentums mit separaten Gesetzen und Instrumenten schützt.
Wenn man ein Design beim DPMA bzw. ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster beim EUIPO schützt, dann hat man ein amtliches Registerrecht mit „Brief und Siegel“. Dies hilft bei der Durchsetzung gegenüber Nachahmer bzw. bei der Vermarktung ganz erheblich. Ein Urheberrecht ist nirgendwo registriert (auch wenn es im Internet einige Bauernfänger gibt, die Ihnen die Aufnahme eines Urheberrechts in private Register anbieten). Wann immer Sie also ein Urheberrecht durchsetzen wollen, müssen Sie erst einmal beweisen, dass es als solches überhaupt schutzfähig ist, dass Sie der Urheber sind, wann das Werk genau geschaffen wurde usw. Das erschwert die Rechtsdurchsetzung so sehr, dass sie in vielen Fällen wirtschaftlich keinen Sinn macht.
Hinzu kommt, dass das Urheberrecht und das Designrecht andere Schutzvoraussetzungen haben. Die Messlatte für Urheberrechtsschutz liegt potenziell höher. Das führt dazu, dass in vielen Fällen, in denen man Designschutz hätte erlangen können, das Urheberrecht nicht greift.
Marken und Designs sind im Ansatz grundverschiedene Schutzgegenstände. Bei Marken handelt es sich um Kennzeichen, die vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden. Demgegenüber sind Designs das äußere Erscheinungsbild eines Produktes bzw. eines Teils davon.
Richtig ist, dass es einige Marken gibt, mit denen Designs geschützt werden. Als Beispiel sind hier zum Beispiel 3D-Marken zu nennen, die berühmte Produktformen zeigen und die vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden (z.B. die Coca Cola Flasche). Andererseits gibt es auch Designs, bei denen es sich eigentlich um Marken handelt, die aber als Muster verwendet werden (z.B. das „LV“ von Louis Vuitton).
Bei solchen Fällen handelt es sich aber um Ausnahmen und nicht um die Regel. Im Normalfall macht es Sinn, Marken als Marken und Designs als Designs zu schützen. Der jeweilige Schutzbereich einer Marke bzw. eines Designs ist dem jeweiligen Schutzgegenstand angepasst und besser geeignet, gegen typische Verletzungsformen vorzugehen. Sollten Sie Zweifel haben, ob sich für Sie besser ein Design oder eine Marke eignet, sprechen Sie uns gerne an.
Das sagen unsere Mandanten
Top Beratung. Faire Preise.
Fachanwalt für Designrecht
Rechtsanwalt Dr. David Slopek hat mehr als 10 Jahre intensive Praxiserfahrung, die er im In- und Ausland gesammelt hat. Nach seinem Studium, dem Erwerb des Master of Laws und des Doktortitels an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wurde er 2012 von der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf zur Anwaltschaft zugelassen. Sein anwaltliches Handwerk hat er von der Pike auf in einer führenden internationalen Großkanzlei gesammelt, für die er rund sieben Jahre lang an den Standorten Alicante und Hamburg tätig war. In 2016 hat die Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg ihm den Titel Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz verliehen. Neben seiner fachlichen Qualifikation ist er mit über 80 Fachveröffentlichungen auch umfangreich publizistisch tätig. Er und sein Team beraten Sie mit Kompetenz und Erfahrung in allen Fragen des Designrechts.